Viele AD(H)Sler:innen kennen folgendes Phänomen: jahrelang hat man sich „durchgewuselt“, unterschiedliche Therapien gemacht, mal was geschafft, oft aber auch nicht, und irgendwie nie genau gewusst, was mit einem „nicht stimmt“.
Und dann, endlich, kommt jemand mit der möglichen Diagnose „ADHS/ADS“ um die Ecke. Man macht sich schlau, man erkennt sich, man wundert/ärgert sich/trauert oder ist auch wütend, warum das noch niemand eher entdeckt hat, schließlich sind doch alle Anzeichen und Symptome recht eindeutig.
Aber nu, jetzt kann es ja weitergehen. Endlich weiß man, was mit einem los ist, dann kann es ja gar nicht mehr so schwer sein, nun endlich überhaupt was zu tun, und das dann auch noch immer 100% richtig und vor allem so, wie man es gerne haben will: absolut perfekt.
Und dann kommt das böse erwachen. Zu wissen, dass man AD(H)S hat, ändert noch gar nix. Und das Schlimmste ist, dass man nun ja sogar weiß, womit man es zu tun hat, und trotzdem funktioniert es/man nicht.
Und dann kommen Medikamente ins Spiel: ohhh Shit…mit deren Wirkung kann man sich besser konzentrieren. Ist in Teilen ganz toll und sehr hilfreich, führt aber regelmäßig bei Menschen in negativen Denkschleifen und -mustern dazu, dass sie sich eben auch besser auf alles Negative konzentrieren können. Auf einmal erkennt man, dass man ja tatsächlich im Zentrum seines eigenen Universums steht, und auch für diverse Scheitereien selbst verantwortlich ist. Das ist noch nicht unbedingt das Ergebnis, welches man sich bei der Nutzung der Medikation versprochen hat.
Das gehört dazu. Sowohl die Wut, die Trauer, der Frust, weil man jahrelang auf unterschiedliche Erkrankungen behandelt wurde, viel Zeit verschenkt hat, und es doch eigentlich sehr offensichtlich war, dass AD(H)S die Ursache ist, als auch, dass man unter den neuen Bedingungen erst mal noch unsicherer und chaotischer ist, und Medikation erst mal gegenteilige Wirkung hat.
Meine Übersetzung dazu war seinerzeit:
Jemand ist bei Windstärke 10 einige Zeit mit seiner Angel auf einem Kutter auf dem Meer, und hat überhaupt kein Problem damit, auf dem schaukelnden Schiff zu sein. Ist mit Angeln beschäftigt, und merkt den Seegang dabei gar nicht.
Aber im Anschluss, wenn die Person wieder an Land ist, und das Schaukeln ist vorbei, dann geht es der Person plötzlich schlecht, weil das Schaukeln nicht mehr da ist, und keine Ablenkung vorhanden, um abzulenken….
Es dauert einfach, bis sich die veränderte Wahrnehmung auswirken kann. Wenn es vorher ohne Medis z.B. einen permanenten Gedankenstrom gab, in dem man sich immer mal wieder verlieren konnte, und da ist plötzlich Ruhe, weiß man das nicht einzuordnen, und reagiert aggro, weil es „anders“ ist…
Ja, AD(H)S und Geduld, dass sind so die Dinge, die überhaupt nicht miteinander harmonieren. Aber es ist nun mal so, dass man „mentale Pfade“, die über Jahrzehnte eingelatscht und etabliert wurden, binnen kürzester Zeit nicht mehr nutzt, und dafür „Alternativ-Strecken“ parat hat, die anders, ruhiger, geplanter, besser verlaufen. Dazu kommt, dass manche dieser Pfade durchaus Teile von „Überlebensstrategien“ sind, mit denen man sich durchgeschlagen hat, um sich zu schützen usw. Das lässt sich nicht so schnell verlernen, wie man es gerne hätte.

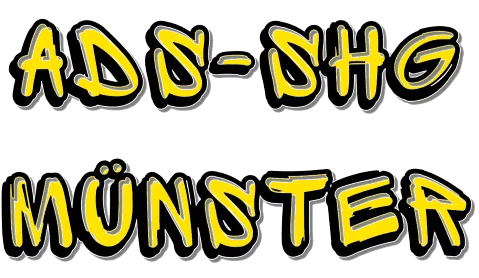

 Jede/r AD(H)Sler:in kennt die Begrifflichkeiten, und ob jemand dann mit H, ohne H oder mit der gemischten Form unterwegs ist, macht regelmäßig in der Größenordnung der Problemstellungen keinen Unterschied. Auf unseren Seiten sind dementsprechend immer beide und auch die gemischte Variante gemeint, wenn es nicht speziell um eine der Möglichkeiten geht.
Jede/r AD(H)Sler:in kennt die Begrifflichkeiten, und ob jemand dann mit H, ohne H oder mit der gemischten Form unterwegs ist, macht regelmäßig in der Größenordnung der Problemstellungen keinen Unterschied. Auf unseren Seiten sind dementsprechend immer beide und auch die gemischte Variante gemeint, wenn es nicht speziell um eine der Möglichkeiten geht.